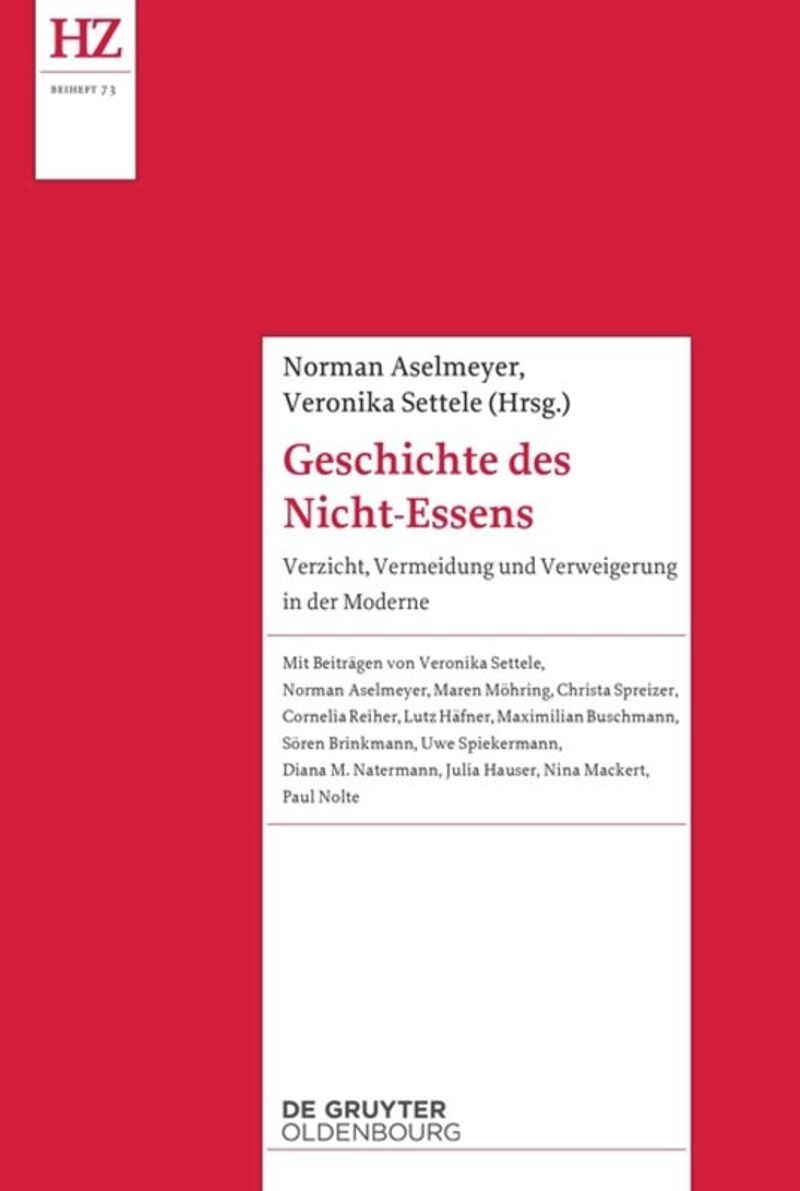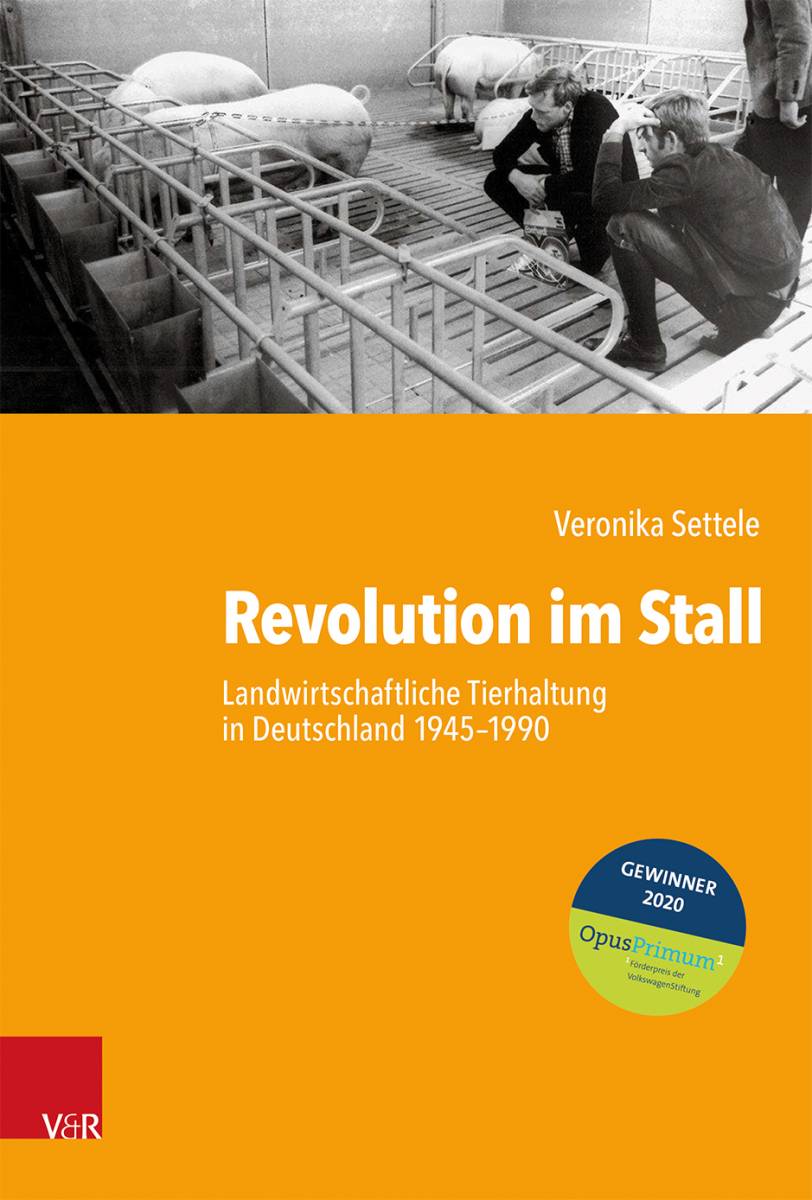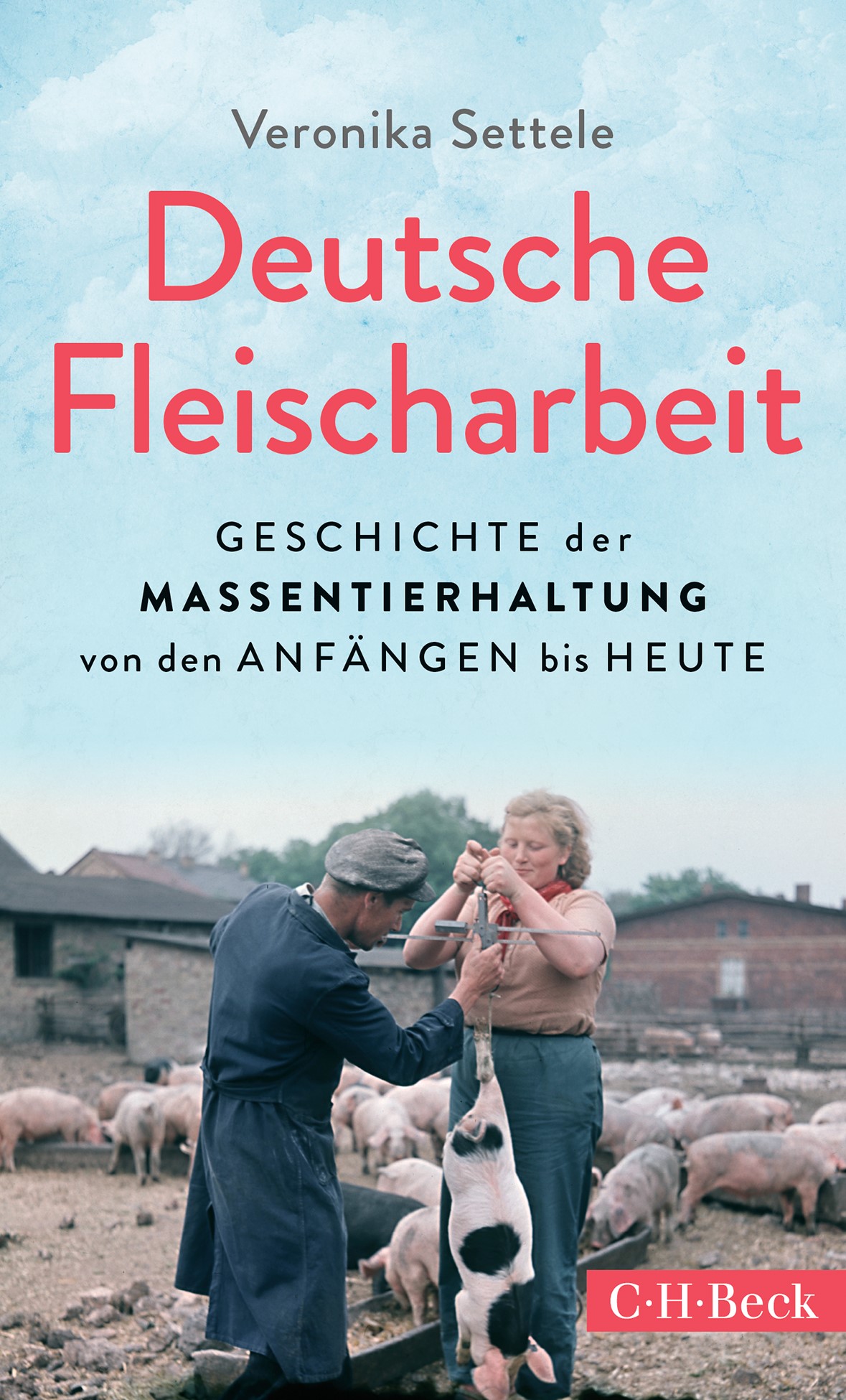Kontakt
Historisches Seminar der LMU
Abteilung Neueste Geschichte und Zeitgeschichte
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Besucheranschrift: Historicum, Schellingstraße 12
Raum:
K 020
Telefon:
089 2180 5558
E-Mail:
Veronika.Settele@lmu.de
Sprechstunde:
Dienstag, 09:30 - 10:30 (digital oder vor Ort in Raum K 020)
Für Termine tragen Sie sich bitte in den digitalen Sprechstundenplaner ein.
Aktuelles
Lesen Sie hier ein Porträt von Veronika Settele im LMU Newsroom.
Montag, 13. Oktober 2025, 20:00 Uhr: Historisches Quartett, Zeitgeschichte in der Diskussion
Ort: Literaturforum im Brecht-Haus, Berlin und Livestream
Diskutiert werden folgende Neuerscheinungen: Heike Behrend, "Gespräche mit einem Toten. Gustaf Nagel, Prophet vom Arendsee“, Ingo Dachwitz/Sven Hilbig, "Digitaler Kolonialismus. Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen“, Ulrich Raulff, "Wie es euch gefällt. Eine Geschichte des Geschmacks“ und Lea Ypi, "Aufrecht. Überleben im Zeitalter der Extreme“
Kurzvita
Veronika Settele ist eine Historikerin des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich für gesellschaftliche Umbrüche und die Wurzeln unserer Zeit interessiert. Seit dem Sommersemester 2025 ist sie Professorin für Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zuvor leitete sie als Vertretungsprofessorin den Arbeitsbereich Neuere Geschichte/Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin (WS 2024/25) und die Abteilung Neuere und Neueste Geschichte der Universität Bremen (WS 2023/24). Seit 2023 ist sie Nachwuchsgruppenleiterin im Fokusprojekt "Hinter der Norm: Praktiken der Sexualität zwischen Säkularisierung und Verwissenschaftlichung, 1848–1930" an der Universität Bremen. Gastaufenthalte führten sie an die Sorbonne Université, die UMR Sirice des CNRS nach Paris sowie an die Princeton University. Ihr erstes Forschungsprojekt (Dr. phil., 2020) untersuchte die wirtschaftliche und moralische Dimension von Ernährung, politischen Handelsbeziehungen und das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren. Dazu erschienen zwei Monografien: Revolution im Stall: Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland, 1945–1990 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, ausgezeichnet mit dem Opus Primum Preis der Volkswagen Stiftung, dem Deutschen Studienpreis und dem Friedrich-Meinecke-Preis) und Deutsche Fleischarbeit: Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute (München: C.H. Beck, 2022).
Ihr aktuelles Forschungsprojekt „Der Sex und die Sünde. Lust und Fortpflanzung im Christentum, Deutschland und Frankreich, ca. 1850–1950“ wendet sich der Geschichte der Sexualität in Europa zu. Praktiken sexueller Lust und (verhinderter) Fortpflanzung werden dabei als religiöses Handeln in der römisch-katholischen Kirche und den protestantischen Kirchen verstanden, die es aufgrund der zentralen Bedeutung von Sexualität sowohl im Alltag der Menschen als auch den religiösen Morallehren erlauben, Veränderungen von Frömmigkeit, kirchlichen Bindungen und dem Glauben selbst nachzuzeichnen.
Das vollständige CV finden Sie hier.
Publikationen (Auswahl)
- mit Claiton Marcio da Silva, The Non-Human in Industrial Agriculture. Technologies of Agriculture and Non-Human Aspects of Farming, in: Emily O’Gorman, Sandra Swart and William San Martin (Hg.), Routledge Handbook of Environmental History, New York 2024, S. 124–141.
- Deutsche Fleischarbeit. Geschichte der Massentierhaltung von ihren Anfängen bis heute, München: C. H. Beck 2022; Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 11061, Bonn 2023; Sonderausgabe der Zentralen für politische Bildung, München 2023.
- Revolution im Stall. Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland, 1945–1990, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020; kartonierte Sonderausgabe 2021.
- Bodies Made Agriculture. How Animals Shaped Intensified Livestock Farming, in: Body Politics 11 (2023), S. 141–167.
- mit Norman Aselmeyer (Hg.): Nicht-Essen. Verzicht, Vermeidung und Verweigerung in der Moderne, Beiheft der Historischen Zeitschrift 73, München 2018.
- Cows and Capitalism. Humans, Animals, and Machines in West German Barns, 1950–1980, in: Review of European History 25 (2018), S. 849–867.
- Oral History in der deutschen Zeitgeschichte. Lutz Niethammer im Gespräch mit Veronika Settele und Paul Nolte, in: GG 43 (2017), H. 1, S. 110–145.
Die vollständige Publikationsliste finden Sie hier.
Laufende Dissertationen
Daniel Costa: Global Cinnamon. Fashioning Intercolonial and Transimperial Connections in the 18th and 19th Centuries
The PhD project is a multilingual global history project bringing together sources related to cinnamon in the context of the spice trade in the Indian Ocean and Atlantic World from 1700 to 1850. It explores the intercolonial as well as transimperial connections fueled by the quest for the spice, in a context often marked by an underlying focus on connections between the colonies and metropoles. Daniel Costa takes his MA dissertation a step further, delving into the pursuit of botanical knowledge related to the commercial routes forged by the rivalry and collaboration which shaped the stances inherent in imperial networks.
Daniel Costa holds a BA in philosophy with First Class Honours (University of London), an MA in English Language Teaching with distinction (University of Southampton) and an MA in history with merit (University of Birmingham). He has written on history and other areas for publications such as the Journal of the Historical Association and Encyclopaedia Britannica. He knows English, Portuguese, Italian, French, Spanish, Greek, Croatian and German, having conducted research in several languages.
Lisa Hellriegel: Von Sittlichkeit zu Selbstbestimmung? Zur gesellschaftlichen und rechtlichen Wahrnehmung sexualisierter Gewalt an Erwachsenen in (west-)deutschen und englischen Großstädten, 1920er bis Ende der langen 1960er Jahre
Wie wandelte sich die gesellschaftliche und rechtliche Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt an Personen über dem Schutzalter zwischen dem Beginn der Weimarer Republik und dem Ende der langen 1960er Jahre? Das bundesrepublikanische Vierte Gesetz zur Strafrechtsreform 1973 begriff sexualisierte Gewalt an Erwachsenen (§ 177 StGB, bis dahin „Notzucht“, seither „Vergewaltigung“) erstmals als Straftat gegen die „sexuelle Selbstbestimmung“, nicht mehr gegen die „Sittlichkeit“. Damit änderte sich die über ein Jahrhundert lang vorherrschende Konzeption sexualisierter Gewalt. Das Projekt fragt, welche Rolle Rechtspraxis und gesellschaftliche Diskussionen zu sexualisierter Gewalt für diesen Wandel spielten. Der Arbeit liegen Gerichts- und Polizeiakten sowie medizinische und psychiatrische Gutachten, Zeitungsberichte und Egodokumente zugrunde.
Lisa Hellriegel studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg. Nach ihrem Masterabschluss 2021 arbeitete sie an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg im Verbund „ForuM“ zur Geschichte sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche Deutschlands nach 1945. Seit 2023 forscht sie im Projekt „Hinter der Norm: Praktiken der Sexualität zwischen Säkularisierung und Verwissenschaftlichung, 1848–1930“ an der Universität Bremen zur Geschichte sexualisierter Gewalt in deutschen und englischen Städten. Sie hat in verschiedenen Sammelbänden und Zeitschriften zu Sexualitätsgeschichte, Geschichte sexualisierter Gewalt sowie Oral History und NS-Erinnerungskultur publiziert.
Downloads
- Settele_CV (264 KByte)
- Settele_Publikationsliste (168 KByte)